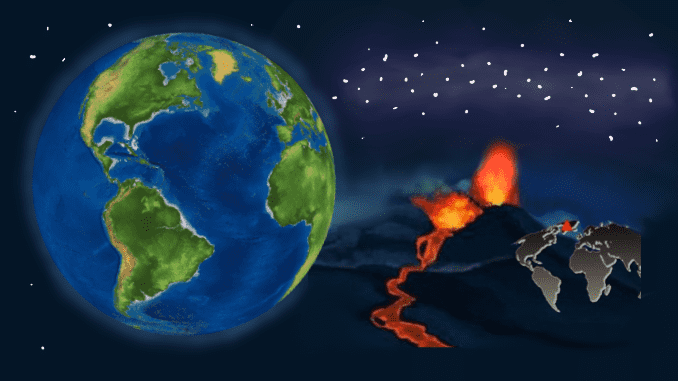
Die Geschichte unseres Blauen Planeten beginnt in einer Zeit jenseits unserer Vorstellungskraft in der Unendlichkeit des Weltalls.
Wissenschaftler schätzen das Alter unserer Erde auf 4.550 Millionen Jahre. In diesem frühen Stadium sprechen sie auch von der „Proto-Erde“, also der Vor-Erde, denn noch war sie nicht so, wie wir sie kennen, und noch fehlte unser Mond. Nach Untersuchung der Gesteinsproben vom Mond setzen die Wissenschaftler sein Alter auf 4.500 Millionen Jahre an. Eine gängige Theorie besagt, dass damals ein anderer Himmelskörper namens Theia, ungefähr so groß wie der Mars, auf die Erde zu gerast und mit unvorstellbaren Wucht auf sie eingeschlagen war. Dabei wurden gewaltige Gesteinsmengen abgespalten, aus denen allmählich unser Mond entstand. Die (Proto-)Erde war durch den Einschlag in ihren Grundfesten erschüttert, die Temperatur schnellte auf 5.000° C hoch und auch festes Gestein wurde wieder eingeschmolzen.

Hadaikum
Das Hadaikum (vor 4.600 – 4.000 Millionen) Jahren umfasst den Zeitraum von der Entstehung der Erde bis zu den ältesten erhaltenen Gesteinen.
Unser „Blauer Planet“ war also in den ersten Millionen Jahren seines Bestehens ein riesiger „Feuerball“. Durch die Weltraumkälte kühlte er allmählich ab; Schwermetalle wie Eisen und Nickel sanken in den Erdkern, leichteren stiegen auf und an einigen Stellen bildete sich eine Kruste aus festem Gestein. Darunter blieb eine Schicht aus schmelzflüssigem Gestein, der Erdmantel. Ständig schlugen Meteoriten auf der glutheißen Erde ein und brachten neue chemische Elemente mit. Ungeheure Kräfte wirkten aus dem Erdinneren, so wurde die Erdkruste über Millionen von Jahren immer wieder gefaltet und ungleichmäßig zerbrochen.
Eine lebensfeindliche Welt
Weite Regionen der Erde waren vulkanisch aktiv. Bei Vulkanausbrüchen stiegen Wasserdampf und verschiedene Gase auf; es entstand eine Uratmosphäre aus Wasserdampf, Kohlendioxid, Stickstoff, Methan und Ammoniak. Für die meisten uns bekannten Lebewesen war dies eine lebensfeindliche Welt: kein Sauerstoff, keine Luft zu atmen, kein Ozon, dass vor den ultravioletten Strahlen der Sonne schützte.
Über Millionen von Jahren kühlte die Erde ab. Schließlich war die Temperatur auf unter 100 ° C gesunken, und aus dem Wasserdampf wurde Wasser. Vor etwa 4.200 Millionen Jahren fiel sintflutartiger Regen, vor etwa 4.000 Millionen Jahren entstanden die Urozeane. Mit dem sintflutartigen Regen begann ein geologischer Prozess: Heftige Niederschläge, Wind und Wetter ließen feste Gesteine erodieren; d.h. sie wurde zerbröselt und vom Wasser weggespült, mitgenommen und an anderer Stelle abgelagert (sedimentiert). So entstanden wieder neue Steinablagerungen, und über Millionen von Jahren, neues Land.

Archaikum
Im Archaikum (vor 4.000 – 3.600 Millionen Jahren) entstanden die ältesten erhaltenen Gesteine, gefunden in Grönland, Südafrika und Australien. Sie sind ca. 3.800-3.500 MioJ alt. An einige Stellen der Erde kann man sie heute sehen, so in der Isua-Formation bei Nuuk im Südwesten Grönlands, im Barberton Greenstone Belt in Südafrika sowie in Yilgarn und Pilbara in Westaustralien.
Urkontinente
Bislang können wir nur Theorien aufstellen, wie die Erde im Archaikum ausgesehen haben mag. Vielleicht war sie eine gigantische Kraterlandschaft aus vulkanischem Gestein, die immer wieder von neuen Vulkanausbrüchen erschüttert wurde. Wissenschaftler nehmen an, dass es nur an einigen wenigen Stellen eine feste Kruste gab, so in Kanada, Grönland und Australien. Vermutlich war die Kruste zu jener Zeit dünner und wurde oft wieder eingeschmolzen.
Die Urkontinente (Kratone) sollen vor etwa 3.700 Millionen Jahren entstanden sein. Manchmal liest man schon von Gesteinen, genauer gesagt „Spuren“ von Gesteinen, die noch älter sind. Vielleicht sind sie sogar 4.000 Millionen Jahre alt. Bei Acasta, hoch im Norden Kanadas, wurden fand man einzelne uralte Minerale in neuerem Gestein. Es ist schwierig, sichere Schlüsse zu ziehen, denn diese uralten Steine wurden im Laufe der Milliarden von Jahren immer wieder verändert.
Erste Spuren von Leben
Vulkane auf dem Meeresboden erwärmten das Wasser, und im Wasser entstand das Leben. Das sind schlichte Worte für ein Wunder. Bis heute können wir nicht mit Sicherheit sagen, wie das Leben auf der Erde begonnen hat. Für die Wissenschaftler steht fest, dass es schon damals die chemischen Elemente auf der Erde gab, die als „Bausteine des Lebens“ gelten: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. DIese reagierten miteinander und bildeten organische Verbindungen, Aminosäuren und Proteine. Diese Verbindungen sind für uns heute genauso wichtig.
Vor ungefähr 3.500 Millionen gab es erste Spuren von Leben im Meer. Das waren die Archaeobakterien, winzig kleine, einzellige Organismen ohne Zellkern (Prokaryoten). Vermutlich lebten diese ersten, winzigen Lebewesen unter extremen Bedingungen am Meeresgrund in der Nähe der „Black Smokers“. Das sind Schlote am Boden der Tiefsee, durch die heißes, mineralreiches und daher dunkles Wasser austritt. Noch heute gibt es Bakterien, die unter ähnlichen Bedingungen in der Tiefsee leben.
Cyanobakterien und Fotosynthese
Aus den Archaeobakterien entwickelten sich Cyanobakterien (Blaualgen). So klein und unbedeutend sie uns heute erscheinen mögen – wir verdanken ihnen unglaublich viel. Diese Bakterien konnten Fotosynthese betreiben, das heißt, sie konnten Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe der Sonnenenergie umwandeln in Zucker, andere organische Verbindungen und .. Sauerstoff, die Grundlage unseres Lebens. Cyanobakterien lebten in Gemeinschaft und bildeten ganze Rasen auf dem Boden flacher Gewässer. Sie betrieben Fotosynthese und schieden Kalk aus. Diese Gemeinschaften wurden immer wieder überlagert, und dann wuchsen die Cyanobakterien wieder nach oben hindurch, dem Licht entgegen.
Stromatholiten
Über Millionen bildeten sich schließlich kleine Hügel. Das waren die Stromatholiten, die Leitfossilien des Präkambriums. In manchen Büchern steht, dass es die ersten Stromatholiten vor 3.500 gegeben hat, andere schreiben, dass es die ersten sicher datierten Stromatholiten vor ungefähr 2.000 Millionen Jahren gab.
Viele Millionen Jahre betrieben die Cyanobakterien Fotosynthese und setzten dabei Sauerstoff frei, aber er wurde sofort im Meer chemisch gebunden; in die Atmosphäre gelangte er im Archaikum noch nicht. Ein geologisches Zeugnis dafür sind die Bändereisenerze aus jener Zeit. Wäre Sauerstoff in der Atmosphäre gewesen, hätte er gleich mit dem Eisen reagiert. Auch dann wäre eine unlösliche Verbindung entstanden, und das Eisen wäre nicht ins Meer gelangt.
Zum Ende des Archaikums gab es eine Reihe von Stellen, an denen die Erdkruste fest und stabil war. Nach und nach wurden diese Stellen größer, verschmolzen mit anderen und bildeten schließlich urzeitliche Kontinentalplatten (Kratone).
Urzeitliche Kontinentalplatten (Kratone)
Zum Ende des Archaikums gab es eine Reihe von Stellen, an denen die Erdkruste fest und stabil war. Nach und nach wurden diese Stellen größer, verschmolzen mit anderen und bildeten nach und nach urzeitliche Kontinentalplatten (Kratone). Der Übergang vom Archaikum zum Proterozoikum ist durch eine grundlegende Veränderung bestimmt: erstmals gelangte freier Sauerstoff in die Atmosphäre!
Der Übergang vom Archaikum zum Proterozoikum ist durch eine grundlegende Veränderung bestimmt: erstmals gelangte freier Sauerstoff in die Atmosphäre!
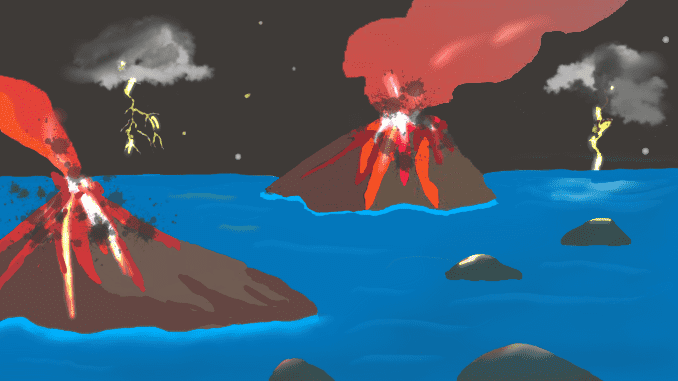
Proterozoikum
Das Proterozoikum (vor 2.500 – 541 Millionen Jahren) ist der mit Abstand längste Abschitt der Erdgeschichte. Das Leben schaffte den Durchbruch im Meer. Zu Beginn des Proterozoikums waren 50-70% der heutigen Kontinentalkruste vorhanden. Die Erdkruste war in eine Anzahl von tektonischen Platten zerbrochen, und diese sind seit jeher in Bewegung, wenn auch nur wenige Zentimeter im Jahr. Über Millionen von Jahren verschmolzen weite Landmassen, kollidierten, formten Superkontinebte und brachen wieder auseinander. Gegen Ende des Proterozoikum gab es die Ur-Kontinente: Gondwana (Antarktis, Afrika, Südamerika, Indien, Australien), Baltica (Nordeuropa), Sibiria und Laurentia (Nordamerika).
Sauerstoff in der Atmosphäre
Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre stieg vor ca. 2.300-2.200 Millionen Jahren rapide an, erstmals gab es einen geringen Gehalt freien Sauerstoffs in der Atmosphäre. Die Ozonschicht bildete sich.
Vor ungefähr 2.100 Millionen Jahren gab es im Meer die ersten Organismen mit einem echten Zellkern (Eukaryoten). Mit Ausnahme der Bakterien sind alle Organismen Eukaryoten, also auch wir.
Die ersten Vielzeller
Vor 1.500 Millionen Jahren tauchten die ersten mehrzelligen Tiere auf. Man nennt man das Proterozoikum auch Kryptozoikum, der Zeitraum des „verborgenen Lebens“. Wir wissen, dass es schon damals einfache, winzige Lebensformen gegeben hat, doch es ist schwierig herauszufinden, wer sie waren und wie sie lebten. Wir lernen über urzeitliche Tiere, indem wir Fossilien untersuchen. Diese Lebewesen hatten jedoch noch keine feste, schützende Schale, die uns hätte erhalten bleiben können.
Schneeball-Erde
Am Ende des Proterozoikums erstarrte die Erde in den vermutlich stärksten Eiszeiten ihrer Geschichte. Das war die Zeit der „Schnellball Erde“ (vor 850 – 635 Millionen Jahren), und bis heute gibt es keine eindeutige Erklärung, wie es dazu kam. Am Ende des Proterozoikums treffen wir auf die ersten Tiere, die uns ihre Spuren hinterlassen haben.
Ediacara-Fauna
Mit den Tierchen der Ediacara Fauna treffen wir die ersten Lebewesen, die ihre Spuren auf der Erde hinterlassen haben, genau gesagt Abdrücke in Schelfsedimenten. Die für uns heute fremdartigen Weichtiere hatten noch keine Hartteile wie Skelette oder Panzer, die als Fossilien hätten erhalten bleiben können. Sie wurden nach dem ältesten und immer noch berühmtesten Fundort benannt, den Ediacara-Hügeln nördlich von Adalaide im Süden Australiens.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar